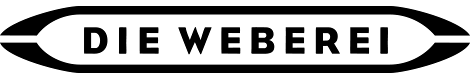(c) Steffen Böning
Nur wer die Niederlage ertragen kann, wird nicht zum Wutbürger
Wir alle kämpfen für unsere Demokratie und versuchen die dafür notwenigen Spielregeln anzuwenden und weiterzugeben. Hinterfragen wir uns jedoch auch einmal kritisch, ob wir dabei nicht zuweilen zu selbstgerecht oder zu gefangen in unserer Szene sind und damit vielleicht sogar anti-demokratische Frustrationsmechanismen beflügeln können.
Frust als Grund zum Verlassen des demokratischen Bereichs
Dass in den aktuellen Zeiten das Wissen über unsere Demokratie und eine Ausweitung der politischen Bildung essentielle Aufgaben – gerade von sozialkulturellen Einrichtungen - sind, darüber herrscht weitgehend Einigkeit. Demokratiefeindliche und -gefährdende Kräfte an den Rändern unserer Gesellschaft müssen eingefangen werden und von dem Wert und der Wichtigkeit unserer demokratischen Ordnung überzeugt werden.
Extreme Positionierungen und Gruppierungen bestehen zu einem Teil zweifelsfrei aus fragwürdigem bis unakzeptablem Gedankengut der entsprechenden Ausrichtung. In Teilen, vielleicht in großen Teilen, jedoch auch aus enttäuschen, frustrierten und sich ausgeschlossen fühlenden Menschen, die durch ihre Zugehörigkeit in einer Randgruppierung ihre Möglichkeit zum Ausdruck der Unzufriedenheit und des Protestes sehen.
Dabei sind diese Extreme, die unsere demokratische Gesellschaft schwächen wollen, nicht nur das politische Rechts oder Links. Neben schlimmen Nazis und linksautonomen Chaoten gibt es in ganz unterschiedlichen Communities Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus, Homophobie und viele weitere undemokratische Erscheinungen.
Frustprotest vermeiden
Wie schaffen wir es nun, im ersten Schritt zumindest die Menschen aus diesen Extremen, die nicht im Einklang mit unseren demokratischen Werten stehen, herauszuholen, die aufgrund von Frust diesen Abweg beschritten haben? Die erste auf der Hand liegende Antwort scheint klar: Den Frust dieser Menschen abbauen! Das ist jedoch ein hehres Ziel. Haben wir alle doch täglich ausreichend Gründe, frustriert zu sein. Eine bessere Möglichkeit ist es sicher, das Münden von Enttäuschungen in einem demokratie- und verfassungsfeindlichen Protest zu unterbinden oder zu vermeiden.
Dazu müssen wir, die wir uns zum demokratischen Kern unserer Gesellschaft zählen, aber auch auf uns selbst schauen. Leben wir tatsächlich eine funktionierende Demokratie vor? Damit ist gar nicht nur das „politische Establishment“ aus sich selbstbedienenden Politikerinnen und Politikern in ihrer Blase gemeint, das sicher für viel Demokratie-Frust verantwortlich ist. Es geht vielmehr auch um das kleine, das alltägliche Vorleben von demokratischen Prozessen und Spielregeln.
In der Demokratie bestimmen Mehrheiten
Im Politik-Unterreicht lernt man, dass in der Demokratie die Mehrheit entscheidet. Um Mehrheiten zu bekommen, muss man argumentieren, diskutieren, überzeugen – im positiven Sinne Lobbyarbeit für seine Idee betreiben und so darauf bauen, eine Mehrheit überzeugen zu können. Im Alltag hat sich jedoch teilweise eine falsche Selbstwahrnehmung eingeschlichen, die man pointiert so beschreiben kann: Meine Idee ist gut, sie ist die richtige und „alle, die ich kenne“ sehen das auch. Also ist sie zu realisieren, am besten sogar mit hoher Priorität. Sollten zur Umsetzung meiner Idee politische oder verwaltungstechnische Entscheidungen notwendig sein, haben diese entsprechend rasch getroffen zu werden. Schließlich ist die Idee ja gut und richtig!
An dieser Stelle fehlt, völlig unabhängig von der Sinnhaftigkeit der Idee, die neutrale Einschätzung, ob wirklich eine Mehrheit vorhanden ist. Habe ich genügend Menschen überzeugt, gerade aus Lagern, die nicht schon zwangsläufig hinter meinem Ansatz stehen? Mein Mann und ich und alle anderen Eltern, die ich gesprochen haben, wollen einen Parkplatz vor der Grundschule, auf dem wir unser Kind in Ruhe aussteigen lassen können. Das ist also umgehend zu realisieren, alles andere ist gefährlich und unsinnig. Aber genauso: Natürlich muss dort eine Fahrradstraße hin. Da fahren doch alle mit dem Rad und regen sich über die Autos auf. Aber hat man wirklich mit den Buskinder-Familien respektive den Berufspendlern gesprochen oder gar mit dem Kämmerer? Habe ich wirklich eine Mehrheit hinter meiner Idee? Oder habe ich mich mit meinen Weggefährtinnen und -gefährten vielleicht im Glauben an das Gute verrannt?
Wer dagegen ist, ist doof und unfähig
Besonders gefährlich wird es für die Vermittlung demokratischer Spielregeln, wenn sogar erkannt wird, dass keine Mehrheit für eine Idee vorliegt, der „Mehrheit, die dagegen ist“ aber der Sachverstand in Teilen sogar die Entscheidungskompetenz abgesprochen wird. Laut Grundgesetzt sind richtigerweise alle Wahlstimmen nicht nur frei, sondern auch gleich. Jeder entscheidungsberechtigte Mensch zählt bei der demokratischen Meinungsbildung gleichviel – egal ob arm oder reich, egal ob clever oder einfältig, egal ob grün oder klimafeindlich.
Natürlich ist es enttäuschend, wenn man eigene Ideen nicht mit einer Mehrheitsentscheidung durchsetzen kann. Natürlich verstehen viele von uns das Wahlergebnis in den USA nicht. Den Amerikanerinnen und Amerikanern dafür aber den Intellekt oder die Fähigkeit abzusprechen, demokratisch korrekt zu entscheiden, ist anti-demokratisch und treibt genau die Frustration, die Menschen in die Extreme abdriften lässt und das Vertrauen in die Demokratie trübt.
Mit Niederlagen umgehen
Statt einer „Mehrheit gegen meine Meinung“ oder dem Ergebnis eines demokratischen Prozesses, das für mich unbefriedigend ist, die Legitimation abzusprechen, müssen wir lernen, damit konstruktiv umzugehen. Wenn ich bei der fairen Verlosung der beliebten Tickets für eine Sportveranstaltung nicht zum Zuge gekommen bin, sondern mein unsympathischer Nachbar, der sich nicht annähernd soviel wie ich für das Event interessiert, muss ich das akzeptieren. Wenn die Mehrheit in der Schulkonferenz den Baum auf dem Pausenhof einem Sportparcours opfern will, muss ich das hinnehmen, auch als Baum-Freund. Ich muss das nicht gut finden. Ich muss, ja ich sollte nicht, resignieren. Aber ich darf nicht zum Wutbürger werden und das System und damit einen demokratischen Grundpfeiler in Frage stellen.
Durch so ein Verhalten, das man leider häufiger antrifft, schüre ich unnötigerweise zusätzliche Aggressionen und Frustrationen, über die sich undemokratischen Kräfte am Rande der Gesellschaft nur freuen. Niederlagen bzw. unterlegen-sein sollte zu neuem Mut antreiben. Ich muss für die nächste Entscheidung noch mehr Menschen überzeugen, mehr informieren, andere Argumente herausarbeiten. Ich muss mir vielleicht auch „Koalitionspartner“ organisieren und dafür akzeptable, aber durchaus schmerzliche Abstriche an meiner Idee in Kauf nehmen. Demokratische Ergebnisse, die ich nicht verstehen und nur schwer annehmen kann, sollte ich analysieren und aus den Ergebnissen neue Argumente für die nächste Entscheidung ableiten. Genau das sollten wir vorleben.
Frühes Trainieren von Verlieren
Das Verstehen und Einüben von demokratischen Prozessen und Spielregeln muss viel früher als mit dem Ausfüllen eines Stimmzettels bei der ersten Kommunalwahl beginnen. Schon in der Kita sollte es Kinderräte geben, die bei ersten Entscheidungen eingebunden werden. Genau dort kann man lernen, wie schön es ist, auf der Seite der Mehrheit zu sein, aber auch wie doof es sich anfühlt, unterlegen zu sein. Wichtig ist, dass alle erkennen, dass der Prozess an sich richtig war und dass eine Demokratie regelmäßig neue Anläufe und andere Entscheidungen ermöglicht. Das kann zum konstruktiven Weitermachen statt zur Frustration beitragen.
Ein Patriarch hat immer das gute Gewinnergefühl, da er immer in seinem Sinne entscheidet. In einer Demokratie sitzt man, wenn man kein Wendehals oder „Fähnlein-im-Wind-Typ“ ist, häufiger auf der Verliererseite. Genau das soll antreiben, Dinge verbessern zu wollen und vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt auf der Gewinnerseite zu stehen. Demokratie ist eben mit einer Entscheidung oder einer Wahl nicht vorbei, sondern ein permanent laufender Motor unserer Gesellschaft.
„Doofes Gefühl“ gibt Kraft, Frust erzeugt Abwendung
Wenn wir es schaffen, Kindern, jungen Menschen und Personen ohne Demokratieerfahrung vorzuleben, dass im ungünstigsten Fall ein Misserfolg mit 49 Prozent der Entscheidungen kein Grund ist, an unseren gesellschaftlichen Spielregeln zu verzweifeln oder sich gar von ihnen abzuwenden, haben wir viel erreicht.
Und bevor jetzt alle nickend weiterblättern, sollten wir uns einmal ganz leise und selbstkritisch fragen, ob auch wir selbst nicht zu häufig die eigene Überzeugung und die von „allen, die ich kenne“ als automatische und logische Mehrheitsmeinung zur Wahrheit erklären. Haben wir vielleicht auch schonmal Andersdenkenden die Legitimation oder Fähigkeit zur Teilnahme an Entscheidungsfindungen abgesprochen? Haben wir vielleicht einmal zu frustriert statt motiviert reagiert, als wir keine Mehrheit für die eigene Idee gefunden haben? Das wäre nämlich undemokratisch...

(c) Steffen Böning
Autor:
Steffen Böning ist Betriebswirt und Geschäftsführer der Bürgerkiez gGmbH in Gütersloh. Er betreibt das sozialkulturelle Zentrum „Die Weberei“ und organisiert kulturelle und soziale Projekt und Events in Quartieren Ostwestfalens. Er engagiert sich beim VskA im Bundesvorstand sowie im Landesvorstand NRW.
Organisation:
Bürgerkiez gGmbH
Bogenstraße 1-8, 33330 Gütersloh