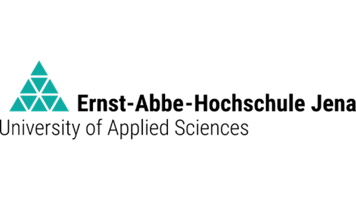(c) Anna Kasten, Christine ten Venne, Miriam Gese
Im Jahr 2005 verabschiedeten die Gründungsmitglieder der Deutschen Gesellschaft für Demokratiepädagogik das „Magdeburger Manifest“, das in 10 Punkten die Förderung demokratiepädagogischer Aktivitäten in Deutschland beschreibt (DeGeDe 2005). Der Punkt acht des Manifests greift den Zusammenhang zwischen Demokratie und Zugehörigkeit auf: „Demokratie wird erfahren durch Zugehörigkeit, Mitwirkung, Anerkennung und Verantwortung.“ (DeGeDe 2005, S. 2). Zugehörigkeit bildet neben Mitwirkung, Anerkennung und Verantwortung die Grundlage für das demokratische Miteinander und für die Aufgaben des Gemeinwesens. Bei der Verschränkung von Demokratie und Zugehörigkeit geht es um Fragen von Solidarität und Vorstellungen des guten Lebens, die in und durch Nachbarschaft real werden können. Die Frage der Zugehörigkeit wird auch mit Hass, Missachtung und Gewalt ausgehandelt. Wie Geflüchtete Schutz suchen und ihnen statt mit Wohlwollen mit Hass, Ablehnung und Gewalt begegnet wird, lässt sich nicht nur in Clausnitz beobachten (Emcke 2016).
Zugehörigkeitsregime im Kontext der FluchtMigration
Zugehörigkeit, Nachbarschaft und FluchtMigration hängen unmittelbar zusammen. Wer dazu gehört oder gehören darf oder wem das Dazugehören gewaltvoll verweigert wird, manifestiert sich im Kontext der FluchtMigration. Menschen mit Fluchterfahrungen werden zu rassifizierten Anderen. Wenn Rassismus und rohe Gewalt den Prozess der Zugehörigkeit beherrschen, wirkt Rassismus als Herrschaftskategorie nie allein, sondern immer in Verbindung mit anderen Herrschaftskategorien wie Geschlecht, Sexualität, Behinderung, Klasse, Alter oder Religion. Zugehörigkeit deckt sowohl die Subjektebene (die Fragen nach Identität und Wohlbefinden) als auch die strukturelle Ebene (die Fragen nach den Möglichkeitsbedingungen wie die Realisierung des Rechts auf Stadt oder die Sichtbarmachung sozialer Ungleichheit) ab. Zugehörigkeit ist ein grundlegendes Bedürfnis menschlichen Seins, aber die Erfüllung dieses spezifischen Grundbedürfnisses ist an gesellschaftliche Strukturen gebunden (vgl. Kubelka 2021, S. 3). Die Zugehörigkeitsverhältnisse „bezeichnen sowohl intimisierte als auch hegemonialisierte Welt-Beziehungen, die Aushandlungen über Beteiligung, Anerkennung, die Verteilung von Ressourcen und Bedingungen zur Beweglichkeit maßgeblich bestimmen“ (Meißner 2019, S. 97-98.). Zugehörigkeit ist ein zentrales Element beim Thema der FluchtMigration. Zwischen den Jahren 1990 und 2008 hat die Ablehnung muslimischer Nachbar*innen zugenommen (vgl. BAMF 2023). Die Nachbarschaft von Asylantragstellenden wird häufiger abgelehnt als die von Zugewanderten aus dem EU-Ausland (vgl. BAMF 2023). Diese Einstellung ist in der Wahrnehmung der Geflüchteten als muslimisch begründet (vgl. BAMF 2023). Rassismus dient dabei als das Wahrnehmungsmuster. Feindliche Klimas gegen vermeintlich Andere und zu Fremden gemachte werden unter anderem durch Proteste in der Nachbarschaft verstärkt, wenn es um die Eröffnung von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete geht (vgl. Lechner und Huber 2017, S. 105). Die Fragen der Herstellung von Zugehörigkeit gehen mit Abwertung und gleichzeitig aber auch mit Solidarität einher. Für Rubia Salgado (2010) macht das Hinterfragen von Zugehörigkeitsordnungen die Konzeption und die Umsetzung einer radikaldemokratischen politischen Bildung aus. Für die Quartiersarbeitenden bedeutet dieses Hinterfragen ein Eintreten „in eine Auseinandersetzung mit ihren Privilegien und mit ihrem eigenen hegemonial strukturierten Hören […], sowie die Fähigkeit [zur Förderung von] […] Dissidenz und Antagonismus“ (Salgado 2010, S. 11-5).
Forschungsprojekt: „Gekommen, um zu bleiben“ – Zugehörigkeitskonstruktionen in der Nachbarschaft in Bieblach-Ost in Gera
Nachbarschaft stellt einen Ort dar, an dem Zugehörigkeiten verhandelt und herausgebildet werden können. Bei dem Zitat „Gekommen, um zu bleiben“ handelt es sich um den Refrain eines Songs der Band „Wir sind Helden“. In dem Refrain heißt es weiter „Gekommen, um zu bleiben – wir gehen nicht mehr weg/Gekommen, um zu bleiben – wie ein perfekter Fleck“. Diesen Versen des Songs widmet sich Sabine Hark und stellt in diesem Zusammenhang die Fragen: „[…] Wem ist es gegeben, zu kommen, um zu bleiben? Genauer: Wem wird das Recht zugestanden, in Gemeinschaft mit anderen zu leben?“ (Hark 2021, S. 37; Hervor. i. O.). Auch das Forschungsprojekt befasst sich mit den Fragen: Wer wird unter welchen Bedingungen zu eine*r*m Nachbar*in wird? Wie wird Zugehörigkeit in und durch Nachbarschaft konstruiert?
Dabei wird der Fokus auf Bieblach-Ost in Gera gelegt. Bieblach-Ost ist ein Stadtteil von Gera, der im Jahr 1986 aufgrund steigender Einwohner*innenzahlen entstand (vgl. Pilz, Lehmann 2006). Die Bevölkerungsstruktur des Stadtteils hat sich in den letzten zehn Jahren deutlich verändert (vgl. Stadt Gera 2021: 12). Es gibt Gemeindeteile von Bieblach-Ost, die Merkmale eines sogenannten „Durchgangsquartiers“ aufweisen (vgl. Stadt Gera 2021, S. 37). Diese Gemeindeteile von Bieblach-Ost lassen sich als benachteiligte Quartiere beschreiben. Kennzeichnend für sie ist, dass es wenig sozial-strukturelle Angebote wie z.B. ärztliche Versorgung oder Einkaufsgeschäfte für den täglichen Bedarf gibt. Auch soziokulturelle Angebote, die Raum für Begegnung bieten, sind kaum vorhanden. Bieblach-Ost ist ein Plattenbaugebiet. Steffen Mau (2019) hat in seiner Untersuchung zur ostdeutschen Transformationsgesellschaft vier Milieus herausgearbeitet, die in vielen ostdeutschen Plattenbauquartieren leben: „die etablierten und lang ansässigen Älteren, sozial Benachteiligte, ostdeutsche Durchschnittshaushalte und, zahlenmäßig etwas kleiner, die Migranten“ (Mau 2019, S. 242). Man kann in Bieblach-Ost ein hohes Maß an Segregation beobachten, was als Indiz für eine deutliche Polarisierung der Einwohnenden und damit Trennung nach Merkmalsgruppen (sozialer und demografischer Status, ethnische Zugehörigkeit) gesehen werden kann. Personen in vulnerablen Lebenslagen wie z.B. Arbeitslosigkeit, FluchtMigration oder psychische Erkrankungen werden auf Wohnungen in diese Gemeindeteile von Bieblach-Ost verteilt. Die Erkenntnisse aus dem Forschungsprojekt sind für die weitere Konzeptualisierung von Nachbarschaftsarbeit von Bedeutung.
Nachbarschaftsarbeit im Kontext der FluchtMigration
Die Nachbarschaftsarbeit stellt eine Arena der Makrosozialarbeit dar. Die Praxis der Makrosozialarbeit verändert die Bedingungen des sozialen Umfelds und adressiert Verletzbarkeiten eines Kollektivs durch das Empowerment der Adressat*innen der Sozialen Arbeit (Tice et al. 2020, S. 4). Die Praxis der Makrosozialarbeit zielt auf die Verbesserung von Chancen auf organisationaler, gesellschaftlicher, legislativer und globaler Ebene ab (vgl. Tice/Long/Cox 2020, S. 3-4), was nicht ausschließt, dass sie in die Herrschafts- oder Exklusionspraktiken eingebunden oder mit ihnen verstrickt ist oder sie reproduziert (Kasten 2022, S. 317).
Eine Aufgabe der Makrosozialarbeiter*innen besteht darin, sich mit essentialistischen und hegemonialen Konzepten von Zugehörigkeit kritisch auseinanderzusetzen, die „auf ein homogen gedachtes weißes deutsches Wir rekurrier[en] und hierzu als abweichend konstruierte ethnische Risikogruppen (vgl. Demirović 2008, S. 243) als defizitäre und fragwürdige Andere erzeugt werden“ (Bücken 2021/2020). Zugehörigkeitsregime sind mit rassistischer und nationalistischer Ideologie verbunden (vgl. Scharathow 2014, S. 45). Im „Kampf um Zugehörigkeiten“ (Dirim/Mecheril 2010, S. 106) sind Makrosozialarbeiter*innen gefragt, ihre eigene Rolle im „Zugehörigkeitsmanagement, das die Einen als zugehörig und die Anderen als Außenstehende ausweist, [kritisch zu befragen]. Dabei sichern sich die Mehrheitsangehörigen das Privileg, in der Norm zu leben und ihre Normalität als verbindlich für die Anderen zu definieren“ (Rommelspacher 2011, S. 32; Hervor. i. O.).
Literatur
Bücken, Susanne (2021/2020): Zur Dringlichkeit einer rassismuskritischen Perspektive für die Kulturelle Bildung in der Migrationsgesellschaft. Machtkritische Reflexionen zu Kultur, Sprache, Nation. In: Kulutrelle Bildung online, Der Wissensspeicher zu Forschung, Theorie & Praxis kultureller Bildung. https://www.kubi-online.de/artikel/zur-dringlichkeit-einer-rassismuskritischen-perspektive-kulturelle-bildung
Demirović, Alex (2008): Liberale Freiheit und das Sicherheitsdispositiv. Der Beitrag von Michel Foucault. In: Purtschert, Patricia/Meyer, Katrin/Winter, Yves (Hrsg.): Gouvernementalität und Sicherheit. Zeitdiagnostische Beiträge im Anschluss an Foucault. Bielefeld: transcript, 229–250.
Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik e.V. (2005): Das Magdeburger Manifest. https://degede.de/wp-content/uploads/sites/14/2018/05/degede__manifest.pdf
Dirim, Inci/Mecheril, Paul (2010): Die Sprache(n) der Migrationsgesellschaft“. In: Mecheril, Paul / u.A.: Migrationspädagogik. Weinheim/Basel: Beltz Verlag, 99–120
Emcke, Carolin (2016): Gegen den Hass. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag
Hark, Sabine (2021): Gemeinschaft der Ungewählten - Umrisse eines politischen Ethos der Kohabitation. Berlin: Suhrkamp.
Kasten, Anna (2022): Digitale feministische Makro(Sozialarbeits)praxis?! In: Soziale Arbeit. Zeitschrift für soziale und sozialverwandte Gebiete, Nr.8-9, 316-321
Kubelka, Julia Katharina Christina (2021): Zugehörigkeit fassbar machen. Die Erzeugung von Zugehörigkeit am Beispiel einer nationalen Minderheit. Dissertation. Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. https://netlibrary.aau.at/obvuklhs/download/pdf/7144460?originalFilename=true
Lechner, Claudia/Huber, Anna (2017): Ankommen nach der Flucht. Die Sicht begleiteter und unbegleiteter junger Geflüchteter auf ihre Lebenslagen in Deutschland. Deutsches Jugendinstitut. https://www.dji.de/veroeffentlichungen/literatursuche/detailansicht/literatur/25854-ankommen-nach-der-flucht.html
Maddox, Amrei/Pfündel, Katrin (2023): Zugehörigkeit und Zusammenleben. Einstellungen in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund aus muslimisch geprägten Herkunftsländern. In: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Forschungsbericht 47. https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Forschung/Forschungsberichte/fb47-muslimisches-leben2020-einstellungen.pdf?__blob=publicationFile&v=11
Mau, Steffen (2019): Lütten Klein. Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft. Berlin: Suhrkamp.
Meißner, Kerstin (2019): Relational Becoming - mit Anderen werden: Soziale Zugehörigkeit als Prozess. Bielefeld: transcript
Pilz, Dagmar/Lehmann, Evelin (2006): 20 Jahre Bieblach-Ost. Eine Präsentation des Deutschen Familienverbandes e.V. Deutscher Familienverband e.V. https://bieblach.de/export/sites/stadtteil-bieblach/.content/pdf/Allgemein/20_Jahre_Bieblach_Ost.pdf
Rommelspacher, Birgit (2011): Was ist eigentlich Rassismus? In: Melter, Claus/Mecheril, Paul (Hrsg.): Rassismuskritik. Band 1: Rassismustheorie und -forschung. Schwalbach/Ts.: Wochenschau Verlag, 25–38
Salgado, Rubia (2010): In der Demokratie gibt es keine Ausnahme. Politische Bildung in der Migrationsgesellschaft. In: Magazin erwachsenenbildung.at 11/2010
Scharathow, Wiebke (2014): Risiken des Widerstandes. Jugendliche und ihre Rassismuserfahrungen. Bielefeld: transcript
Stadt Gera (2021): Sozialstatistik der Stadt Gera 2021. Sonderauswertung zum Stadtgebiet Gera Bieblach – Zwischenbericht zur Sozialraumanalyse im Planungsraum Bieblach/Tinz. Stadtverwaltung Gera. https://www.gera.de/leben-in-gera/gesundheit-soziales/soziale-projekte/integrierte-kommunale-sozialplanung/sozialberichterstattung-/-sozialstatistik
Tice, Carolyn J./Long, Dennis D./Cox, Lisa E. (2020): Macro Social Work Practice. Advocacy in Action. Thousand Oaks: SAGE Publications

(c) Anna Kasten, Christine ten Venne, Miriam Gese
Autorinnen:
Miriam Gese ist Sozialarbeiterin (B.A.) und zertifizierte Antidiskriminierungsberaterin. Neben ihren beruflichen Tätigkeiten in den Bereichen der stationären Kinder- und Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Geflüchtete und der aufsuchenden Verbraucher*innenarbeit, ist sie als Lehrbeauftragte für Methoden der Sozialen Arbeit an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena tätig.
Anna Kasten, Prof. Dr., hat die Professur für Soziale Arbeit mit den Schwerpunkten Gender und Diversity an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena inne. Sie ist Diplom-Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin und Soziologin. Darüber hinaus ist sie Trainerin und Coach für transkulturelle Kompetenzen. In ihrem aktuellen Forschungsprojekt beschäftigt sie sich mit den Diversitätspolitiken in Ostdeutschland.
Christine Ten Venne ist dilpomierte Sozialarbeiterin, zertifizierte Mediatoren und Antidiskriminierungsberaterin. Neben ihren beruflichen Tätigkeiten im Bereich der Gefährdetenhilfe und aufsuchende Verbraucher*innenarbeit ist sie als Lehrperson für Methoden der Sozialen Arbeit an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena freiberuflich tätig.
Organisation:
Ernst-Abbe-Hochschule Jena, Fachbereich Sozialwesen
Carl-Zeiss-Promenade 2, 07745 Jena